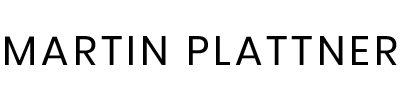Kinderköpfe / Kindsköpfe
In Erinnerung an den Maler Karl Plattner
Der Tod wird kommen und kein Ende setzen.
Denn weil das Gedächtnis der Menschen nicht reicht,
ist das Gedächtnis der Familie da, eng und beschränkt, aber ein
wenig länger.
(Ingeborg Bachmann)
Kaum gekannt habe ich ihn, den Karl Plattner, auch wenn wir uns die bockigen, kahl gewordenen Äste eines Stammbaums teilen. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Karl war mein Großonkel, aber nahezu alle Familienmitglieder (die Mama, die Oma, der Opa, die Tanten, die Cousinen …) setzte und setzen noch immer ein kollektives „Onkel“ seinem Namen voran. Über Onkel Karls Hände wurde manchmal geredet – also nicht nur darüber, was sie hervorzubringen vermochten, sondern über seine Hände an sich – groß sollen sie gewesen sein (ich kenne sie nur von Fotos und da erscheinen sie auch mir anständig groß). Über seine Stimme wurde gesprochen – „eigen“ sei sie gewesen (das kann ich bestätigen, ich habe aber nur einmal mit ihm telefoniert). Im Jahr seines Todes (1986) war ich elf Jahre alt. Die ver- und zerstreute Familie traf sich selten, am ehesten noch zu Beerdigungen, viele davon im Vinschgau. Und so auch jenes Mal: Beim Begräbnis von Karl in Mals begegneten sich die ihn überlebenden Geschwister samt Kindern und Kindeskindern. Mein Opa, der Bruder von Karl, konnte nicht zur Grablegung mitfahren – er war gerade selbst mit Sterben beschäftigt.
Zum Werk Karl Plattners kann ich vielleicht ein wenig mehr sagen (na, immerhin!), auch wenn ich so gar kein Kunsthistoriker bin. Seine Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken begleiten mich seit meiner frühesten Kindheit. Sie sind das, was man, neben dem Gesicht der Mama und dem Gesicht der Oma, als ersten „großen“ Eindruck bezeichnen kann – Bilder, die sich mir eingebrannt haben, Bilder, die nicht mehr abzuschütteln sind (ich habe es mehrfach versucht, zwecklos). Als Kind entwickelte ich eine richtiggehende Angst vor einigen dieser Bilder: die geritzten Kinderköpfe, die wie (ab)sterbende Greisinnen und Greise dreinschauen; die unheimlichen Fenster und Balkone, in oder auf denen Menschen wie in Schockstarre verharren, bereit sind zum Springen, sich manchmal fallen lassen sogar. Landschaften, die ohne viel Himmel auskommen müssen; und wenn der Himmel dann doch auftaucht, verheißt er vieles, nur keine Befreiung – zu gesättigt sind sie, diese Himmel, als könnten sie jeden Augenblick aufplatzen und die Schauenden unter ihren wahrlich himmlischen Farbverläufen (lebendig) begraben.
Andererseits, da ist auch Humor in Karl Plattners Bildern (das habe ich aber erst als sogenannter Erwachsener erkannt). Zugegeben: ein verhaltener, melancholischer, dunkler Humor. Die isolierten Frauen auf „Zwei Balkone“ müssen ihr Stehen tatsächlich ohne Beine beherrschen! „Michael Gaismair“ schaut drein wie meine Uroma auf dem Foto vom Tag ihrer Hochzeit (1903)! Ein Bischof, der sich in „Der Spiegel“ in seinem Messgewand verheddert, ja, geradezu teuflisch scheitert am eigenen Ornat! Und schließlich jener Mensch, der in „Sonderbare Begegnung“ auf ein (Vinschger?) Schaf trifft, das ihm zum Verwechseln ähnlich schaut! Es ist vielleicht nicht gerade zum Lachen (höchstens eines, das einem erschrocken auskommt), aber zum Schmunzeln ist es, zumindest für mich.
Und dann gibt es da noch etwas Rätselhaftes an und in seinen Bildern, etwas, das ich kaum benennen kann. Stimmungen, die an Träume erinnern – Klarträume (ein jener Moment, in dem sich die Träumenden im Traum bewusst werden, was ihnen da gerade geschieht: Träumen). Als Kind habe ich oft von den Bildern Karl Plattners geträumt, vermutlich, weil ich vor dem Einschlafen und gleich nach dem Aufwachen immerzu auf eines von ihnen schaute – über meinem Gitterbett hing, beabsichtigt oder nicht, die Farblithographie: „Der Käfig“. Heute frage ich mich manchmal: Hat er mit und in seinen Bildern auch eine Art Traumarbeit geleistet? Wovon hat er wohl selbst so geträumt? Ich weiß es beim besten Willen nicht.
Meine Oma hatte eine Foto-Schatulle. In hinreißender Unordnung lagen da auf- und übereinander: lebende und tote Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, Haustiere, Dorf-, Gebäude- und Straßenansichten … Das reinste Familiengrab! Auch der Onkel Karl kam da vor: mit seiner Frau Marie-Jo und ihren zwei Töchtern in Brasilien; seltsam verändert am Tag des Begräbnisses seiner Mutter in Mals (1969); auf einem Pferd hockend – wieder in Brasilien … Auf der Rückseite des letzten der genannten Fotos hat er eine kurze Grußbotschaft an meinen Opa gerichtet: „Auf der Fazenda! Dein Bruder Karl.“ Seine Handschrift steht dabei in unheimlichem Kontrast zu den legendär großen Händen: winzig, spitzig, eine gotische Miniatur.
Leid tut es mir, dass ich meine Überlegungen zu Karl nicht stringenter aufschreiben kann. Ich habe es versucht – es jagen mir aber einfach zu viele konkrete und noch viel mehr unkonkrete Gedanken (in ihrer häufigsten Form: als Fetzen!) durch meinen Kopf (schreib es doch: durch deinen Kindskopf! Trau dich halt schon!). In meinem Büro in Wien – es befindet sich in einem Atelierhaus voll von malenden, zeichnenden und radierenden Menschen – habe ich mich inzwischen wieder mit Arbeiten von Karl umgeben (fast schon umzingelt). Eines davon: ein Kinderkopf, der so gar nichts von einem Kindskopf hat. Ein lächelndes und dennoch zutiefst ängstliches Gesicht, dem man alles schon ansieht: das, was zu leben geht; und das, was schwer zu leben gehen wird; und das, was niemand überleben kann – das eigene Sterben. (…) Ein Kind, das sein kommendes Totsein in einem fort übt.
Vor einigen Wochen wäre Karl Plattner 100 Jahre alt geworden. An diesem Tag habe ich (Kindskopf!) ihm eine „Ofrenda“ – einen Erinnerungsschrein – aufgebaut: mit frischen Nelken, alten und neuen Pinseln, Fotos, mexikanischen Kerzen und wollenem Totenkopf. Lange saß ich vor dieser Ofrenda. Nervös. Fragend. Mein (An)Denken schien mir unzureichend; schien mir „eng und beschränkt“. Aber dann halt doch auch: „… ein wenig länger“.
Martin Plattner
Erstveröffentlicht in: kulturelemente, Bozen, April 2019